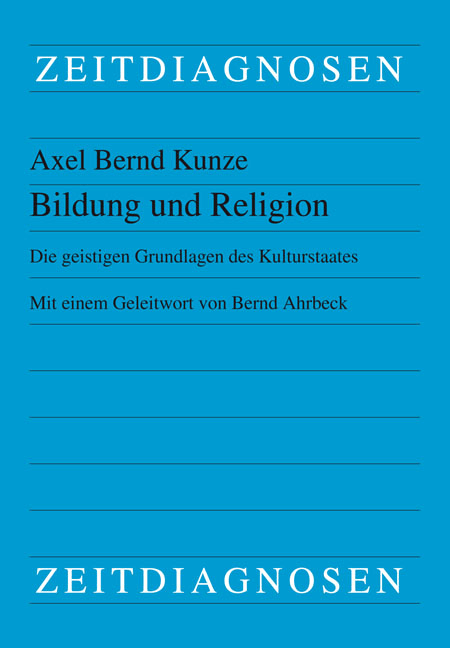Der folgende Beitrag wurde am 17. Dezember 2022 als Vortrag auf einer wissenschaftlichen Tagung an der Universität Trier gehalten.
Freiheit verwirklicht sich im bleibenden Spannungsfeld zwischen der Achtung vor dem Einzelnen und den Interessen der Gemeinschaft. Die ethische Tradition kennt die Unterscheidung zwischen dem guten Willen und der richtigen Tat. Angesichts begrenzter Ressourcen ist das moralische Maximum keineswegs schon das politisch Richtige. Unter der Bedingung stets begrenzter Ressourcen bleibt politisch und ethisch immer wieder zu unterscheiden zwischen grundsätzlichem „Wohl-Wollen“ und abwägendem „Wohl-Tun“. Individual- und Gemeinwohlbelange, kurz- und langfristige Folgen, der mögliche Nutzen und die möglichen Übel verschiedener Handlungsoptionen sind bei einer sorgfältigen Güterabwägung differenziert wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Eine Verantwortungsethik, der dies gelingen soll, kommt nicht ohne die Anwendung ethischer Vorzugsregeln aus – ein sozialethisches Methodenwissen, das allerdings nicht mehr selbstverständlich ist, sondern zunehmend strittig wird, wie Katharina Klöcker in einer Studie zum Vergleich von katholischer und evangelischer Migrationsethik feststellte (vgl. Katharina Klöcker: Differenzierter Konsens in der Ethik am Beispiel der Flüchtlingsfrage, in: zur debatte [2020], H. 4, S. 21 f.).
Vor Jahren haben alle gerufen, Bildung sei das Wichtigste – und alles musste sich dem Thema Bildungsgerechtigkeit unterordnen. In der Coronakrise war auf einmal Gesundheit das Allerwichtigste – und alles muss dem Gesundheitsschutz untergeordnet werden. Und morgen …!? In einer politischen Debatte, die für einzelne Themen immer gleich einen absoluten Vorrang postuliert, bleibt kein Spielraum für differenzierte Abwägungsprozesse. Wo zunehmend moralisierend diskutiert wird (Haltungswissenschaft, Haltungsjournalismus, Haltung zeigen gegen …), da muss man keine ethischen Vorzugsregeln anwenden: Da gibt es nur noch Schwarz und Weiß, absolut Gut und absolut Böse. Die Folgen sind deutlich spürbar: Die Fähigkeit zur differenzierten ethischen Güter- und Übelabwägung kommt abhanden.
Vorzugsregeln verdanken sich der Erkenntnis, dass verantwortliche Urteile einer sorgfältigen Abwägung und differenzierten Begründung bedürfen. Sie verlieren allerdings dort an Bedeutung, wo es vorrangig darum geht, Haltung zu zeigen, statt hart, aber fair über kontroverse Positionen zu streiten und um das bessere Argument zu ringen. Eine affektgeleitete Politik, die sich der vergleichenden Beurteilung und rationalen Abwägung verweigert, verspielt auf Dauer an Kompetenz, Vertrauen und Überzeugungskraft. Im Folgenden soll diskutiert werden, welche Rolle dabei die politische Tugend der Kompromissfähigkeit spielt – unter Rückgriff auf zwei schon ältere, aber keineswegs überholte theologische Stimmen, die sich mit der ethischen Seite des Kompromisses beschäftigt haben.
Die Überlegungen folgen dabei folgender Gedankenkette: Situation – Kompromiss – Gewissen – Rote Linien.
1. Die Situation
Der Mensch ist ein geschichtliches Wesen, seine Existenz bleibt sozialem Wandel unterworfen. Im politischen Raum entstehen immer wieder neue, wechselnde Situationen, die bewältigt werden müssen. Wir erleben dies gegenwärtig sehr stark, wenn von Zeiten multipler Krisen oder auch multipler globaler Krisen die Rede ist.
Die Grundaufgabe der politischen Teilpraxis ist es, das Zusammenleben zu erhalten und zu gestalten. Die politischen Institutionen sollten dabei dazu beitragen, den Wandel im Zusammenleben gestaltbar und berechenbar zu machen. Doch behält politisches Handeln auch bei funktionierenden Institutionen unabweisbar einen deutlich situativen Charakter. Prinzipien, also ethische Auslegungsregeln, und Normen geben dabei Orientierung und entlasten von notwendigen und immer wiederkehrenden Alltagsentscheidungen zugunsten von Entscheidungen bei gravierenden oder neuartigen Konfliktlagen. Eine Norm kann als sittliches Vorzugsurteil verstanden werden, bei dem Werte unter konkreten Handlungsbedingungen abgewogen werden. Die politische Urteilsbildung erfolgt unter Abwägung längerfristig wirkender Wertpräferenzen, der Folgen der jeweiligen Handlungsalternativen für die Zukunft und der gegebenen empirischen Sachverhalte. Was in einer ganz konkreten Situation das Gute und das Bessere ist, lässt sich nicht aus Prinzipien und Normen ableiten; das muss durch Analyse der Situation und ethische Güterabwägung mit Hilfe der Prinzipien und Normen beurteilt werden.
Mit der Situation kommt die pragmatische und strategische Seite politischen Handelns in den Blick: „Politik heißt […] erträgliche Arrangements finden, Interessen miteinander vermitteln, Kompromisse einzufädeln, Verbündete finden, die richtigen Personen als Mitarbeiter wählen, den geeigneten Zeitpunkt wittern, Opposition einkalkulieren, Zustimmung erringen, Mehrheiten zusammenhalten, öffentliche Meinung beeinflussen.“ – so der Eichstätter Politikdidaktiker Bernhard Sutor in seiner Politischen Ethik (Kleine politische Ethik, Bonn 1997, S. 46). Dabei bleiben für politische Situationen, wenn diese einmal gemeinschaftlich als solche gewertet worden sind, konfligierende Problemdefinitionen, Zielsetzungen und Handlungsoptionen bestimmend. Einfach „durchzuregieren“, bleibt eine naive und gefährliche Vorstellung. Es braucht verlässliche Regeln, die miteinander konkurrierenden Interessen und Positionen zu verhandeln sowie in Aushandlung und Abstimmung zu einem Ausgleich zu bringen.
Für politische Zusammenarbeit ist nicht eine Einheitlichkeit in der politischen Meinung notwendig, die auch nur um den Preis der Freiheit möglich wäre, wohl aber eine Einigung im Wollen, politische Lösungen überhaupt anzustreben und gemeinsam auszuhandeln. Politik lebt davon, dass akzeptiert wird, zwischen einem legitimen Interessendissens auf der einen und einem notwendigen Regelkonsens auf der anderen Seite zu unterscheiden. Eine politische Tugend, die für die Wahrnehmung politischer Verantwortung unverzichtbar bleibt, ist Kompromissfähigkeit. Diese soll im Folgenden näher in den Blick genommen werden.
2. Der Kompromiss
Der politische Kompromiss hat nicht immer den besten Ruf. Er gilt mitunter als Kuhhandel, Verrat, Selbstpreisgabe oder faules Fallobst. Ja, es kann faule oder falsche Kompromisse geben. Und falsche „Kompromisslerei“ aus feiger Bequemlichkeit. Tragfähige politische Kompromisse hingegen setzen ethische Anstrengung voraus.
Der Kompromiss kann verstanden werden als eine Form handlungsorientierter Konfliktbearbeitung, bei der widersprüchliche Interessen, Standpunkte oder Positionen konstruktiv bearbeitet und zu einem Ausgleich gebracht werden sollen. Fortbestehende Differenzen werden nicht geleugnet. Doch eröffnet ein Kompromiss den beteiligten Akteuren neue Entscheidungs- und Handlungsspielräume, verlangt ihnen aber nicht ab, die eigene Identität aufzugeben. Der Kompromiss setzt einen Grundkonsens im gesellschaftlichen Ethos voraus: Der Kompromiss respektiert die verschiedenen politischen und weltanschaulichen Überzeugungen, achtet aber zugleich handlungsbezogene Entscheidungen, die auf Basis dessen gefällt werden, was aktuell und unter Beachtung der bestmöglichen Sorgfalt einsehbar ist. Das heißt dann auch: Derartige Entscheidungen sind geschichtlich überholbar und müssen immer wieder neu erarbeitet und verantwortet werden. Die Verfassung gibt hierfür den notwendigen Rahmen, hebt aber nicht die immer wieder notwendige Anstrengung zum Kompromiss auf.
Der Kompromiss ist eine bürgerlich-politische Tugend, die innerhalb der pluralen Gesellschaft ein Analogon zu den Entscheidungsmechanismen politischer Partizipation darstellt und zugleich ein Korrektiv zum Mehrheitsprinzip der Demokratie bildet.
Ich mag mich irren: Aber in der theologischen Ethik bis heute nicht übertroffen, bleibt jene Abhandlung zum Kompromiss, die Helmut Thielicke diesem in seiner „Theologischen Ethik“ gewidmet hat (vgl. Helmut Thielicke: Theologische Ethik, Bd. II: Entfaltung, Teil 1: Mensch und Welt, 5. durchges. u. wesentl. erw. Aufl., Tübingen 1986, S. 67 – 85). Für Thielicke gründet der Kompromiss in der Vorläufigkeit irdischer Existenz und einer zu Ende gehenden, der Vollendung entgegengehenden Welt. Die „Reinheit irdischer Existenz“ stoße unter diesen Vorzeichen immer an die Grenze der zur Verfügung stehenden Mittel und ihrer Eigengesetzlichkeit und mache daher Zugeständnisse an die realen Verhältnisse unumgänglich. Für Thielicke ist daher jede realistische Ethik immer schon eine „Ethik des Kompromisses“. Auch der Christ müsse „coram deo den Zwiespalt aushalten“, der sich aus dem De-facto-Kompromiss im menschlichen Leben und den radikalen Forderungen Gottes ergebe. Diesen Zwiespalt auflösen zu wollen, führe in schwärmerischen Radikalismus oder menschliche Tragik. Wenn es diesen Zwiespalt auszuhalten gilt, sagt das aber auch: Das Wissen um die Vorläufigkeit der Welt und die Notwendigkeit des Kompromisses darf nicht in dem Sinne zu einer Tugend gemacht werden, dass von vornherein ein reduziertes Sollen in Kauf genommen wird. In der Alltagssprache klingt das dann oft so: Letztlich sind wir alle korrumpiert. Und nachts sind eben alle Katzen grau.
Thielickes Position ist theologisch nicht unwidersprochen geblieben. An dieser Stelle nur ein Beispiel: So hat Gerhard Lohfink (vgl. Gesetzeserfüllung und Nachfolge. Zur Radikalität des Ethischen im Matthäusevangelium, in: Helmut Weber [Hg.]: Der ethische Kompromiß, Freiburg i. Brsg. u. a. 1984, S. 15 – 58, hier: 49 f.) seinem Hamburger Kollegen vorgeworfen, den Kompromiss pervertiert zu haben, indem er ihn generalisiert und auf den intrapersonalen Raum ausgeweitet habe. Mit der Folge, dass der Einzelne nach Thielicke praktisch gar nicht mehr anders leben könne, als beständig schlechte Kompromisse einzugehen. Lohfink hingegen will den Kompromiss strikt auf den Bereich pluralistischer Sozialgebilde beschränkt sehen und ansonsten von Güterabwägung sprechen.
Eine katholische Stimme, die sich zeitgleich wie Thielicke mit dem Kompromiss beschäftigte, war der katholische Ethiker Johannes Messner. In seinem Standardwerk zum Naturrecht (vgl. Johannes Messner: Das Naturrecht. Handbuch der Gesellschaftsethik, Staatsethik und Wirtschaftsethik, 3., neubearb., wesentl. erw. Aufl., Innsbruck u. a. 1958, S. 721 – 724) bezeichnet er den Kompromiss als „Prüfstein der Demokratie“.
Auch für Messner zeigt sich der demokratische Konsens weniger an der Zustimmung aller an einer Entscheidung beteiligten Akteure, sondern vielmehr in einer kompromissbereiten Einigung, bei der die unterschiedlichen Meinungen weiterhin bestehen bleiben. Demokratische Mehrheiten können wechseln; die Zustimmung der unterlegenen Seite bedarf des Vertrauens, in einer anderen Streitfrage auch einmal der abstimmungsstärkeren Seite angehören zu können. Der Kompromiss, so Messner, fuße auf dem Vertrauen der einzelnen kollektiven Akteure, die an ihm beteiligt sind, in ihre eigene Gestaltungsmacht, aber genauso in die Wirkmacht der Vernunft. Beides wird beschädigt, wenn Etikettierung, Moralisierung oder Emotionalisierung das Argumentieren ersetzt.
Messner unterscheidet zwischen „echten“ und „taktischen“ Kompromissen. Der echte Kompromiss gründet auf einem möglichst weitgehenden Konsens, dem alle Beteiligten vor ihrem Gewissen zustimmen können. Für den politischen Prozess bedeutet dies, dass solche Kompromisse auch von der Opposition mitgetragen werden und auch bei geänderten Mehrheitsverhältnissen Bestand haben können. Häufiger ist hingegen der taktische Kompromiss. Politische Akteure retteten sich damit über Zeiträume, in denen die „demokratische Maschinerie“, wie Messner formuliert, ins Knirschen gerät, oder man erheischt damit die Zustimmung anderer Parteien, auf die man zwingend angewiesen ist.
Für Messner ist eine solche „Politik des kleineren Übels“ grundsätzlich berechtigt, aber sie darf nicht zum Normalfall der Politik werden. Dann drohten zwei Gefahren: Entweder verliert eine Partei auf Dauer ihre Gemeinwohlorientierung und orientiere sich einseitig an ihrer „Parteidogmatik“. Wir könnten fragen, ob wir das möglicherweise gegenwärtig in der Energiepolitik im Allgemeinen und der Kernenergiepolitik im Besonderen erleben.
Oder die ethische Anstrengung, welche der Kompromiss voraussetzt, degeneriere zum dauerhaften Opportunismus. Jedem fallen sicher politische Beispiele ein: Politiker, die sehr frei nach Luther der Devise folgen: „Hier stehe ich, ich kann auch jederzeit anders.“ Der Kompromiss beinhaltet den Willen, sich bei der politischen Lösungssuche an ethischen Prinzipien und am Allgemeinwohl zu orientieren. Für Opportunisten gilt dies nicht, weshalb Messner sehr deutlich folgert, dass sich die am Gemeinwohl orientierte Mehrheit derartig prinzipienlos agierenden politischen Akteuren verweigern sollte. Taktische Kompromisse seien auf Dauer nur begrenzt tragfähig. Wo diese aus Opportunismus überhandnehmen, untergräbt die Politik das Vertrauen, auf das sie angewiesen ist, und engt über kurz oder lang ihre eigenen Entscheidungs- und Handlungsspielräume gefährlich ein.
Dass Kompromisse ethischer Anstrengung bedürfen, bestätigt auch Thielicke: Die bismarcksche Formel von der Politik als „Kunst des Möglichen“ stellt für ihn sogar ein „Paradigma des Lebens“ (Thielicke: Theologische Ethik II/1, S. 81) überhaupt dar. Ohne Kompromisse könnte der Mensch gar nicht leben und überleben. Allerdings seien Kompromisse, nur weil wir ohne sie gar nicht auskommen können, damit keineswegs ethisch neutral. Der Kompromiss ist keineswegs so etwas wie eine mathematische Formel. Vielmehr beinhalte jeder Kompromiss eine Entscheidung, so Thielicke. Wörtlich: „Die Sach- und Personwerte, zwischen denen der Kompromiß zu vermitteln hat, können so heterogen sein, daß sachliche Kriterien überhaupt versagen und ausschließlich ein wagender Akt der Entscheidung hilft“ (ebd., S. 83).
Kompromissfindung ist ein Prozess kommunikativer Verständigung, der im Ideal als gemeinsamer Lernprozess verstanden werden kann: divergierende Standpunkte werden wahrgenommen, Argumente geprüft, Alternativen abgewogen. Kompromisse fallen in der Regel dort leichter, wo für das zur Verhandlung Stehende ein Äquivalent vorhanden ist. Der Theologe und Soziologe Nikolaus Monzel schrieb Ende der Fünfzigerjahre (im Anschluss an Messners Lehre vom Kompromiss): „Je weniger eng und notwendig ein Mittel mit einem bestimmten politischen oder gesellschaftlichen Ziel verbunden ist, desto eher läßt sich ein endgültiger Kompromiß in der Wahl der Mittel rechtfertigen. Erscheint jedoch das Streitobjekt als das allein geeignete beziehungsweise als das einzige Mittel, das nicht in sich schon sittlich verwerflich ist, dann wird der so Urteilende und verantwortungsbewußt Handelnde nur einen vorläufigen Kompromiß abschließen; denn auf ein solches Mittel endgültig zu verzichten, hieße ja, das erstrebte Ziel aufzugeben“ (Nikolaus Monzel: Der Kompromiß im demokratischen Staat. Ein Beitrag zur politischen Ethik, in: Hochland 51 [1958/59], S. 237 – 247, hier: 242 [im Original sind „endgültiger“ und „vorläufigen“ kursiv hervorgehoben]).
Da politische Kompromisse in aller Regel von korporativen Akteuren geschlossen werden, kann sich die geforderte Kompromissbereitschaft nicht allein auf individuelle Tugenden stützen. Politische Organisationen sind nicht über moralische Appelle steuerbar. Es bedarf institutioneller Absicherungen, etwa geregelter Vermittlungsverfahren.
Der Kompromiss ist eine Form des friedlichen Interessenausgleichs unter Verzicht darauf, die eigene Machtüberlegenheit gewaltsam auszuspielen. Klaus Peter Rippe (Moralische Meinungsunterschiede und Politik, in: Josef Römelt: Ethik und Pluralismus, Innsbruck 1997, S. 117 – 154) nennt drei Regeln, die für beide Gesprächsseiten gelten müssen, wenn eine faire Aushandlung möglich sein soll: (1.) Der gegnerischen Partei darf die Anerkennung als moralische Position nicht versagt werden, was etwa bei Ad-hominem-Argumenten der Fall ist. (2.) Kompromissbildung darf nicht von vornherein als unmoralisch betrachtet werden. (3.) Empirische Fragen dürfen nicht in moralische Grundsatzfragen übersetzt werden.
Anders gesagt: Der Kompromiss erfordert die Freiheit aller beteiligten Akteure, sich gleichberechtigt und wohlinformiert am Aushandlungsprozess zu beteiligen. Was allerdings nicht bedeutet, wie wir noch sehen werden, alle Positionen tatsächlich gleich zu gewichten. Es bedeutet jedoch, die Gewichtung der vorgetragenen Argumente selbst in die Diskussion einzubeziehen und methodisch kontrolliert zu reflektieren.
Kompromisse werden nicht dadurch erschwert, dass programmatische Unterschiede herausgearbeitet werden, sondern dass eigentliche Gegensätze verschleiert werden und ausgleichsfähige Positionen fehlen: „Nicht das Zusammenfließen in die Einheit der spannungslosen Ungeschiedenheit, […] gilt es zu fördern, sondern das Zusammentreten, das Zusammenwirken, d. h. die Kooperation des charakteristisch je anderen gilt es zu erreichen“ (Max Müller: IV. Abhandlung. Sinn-Verwirklichung oder Über Wert und Würde des Kompromisses, in: Ders.: Der Kompromiß oder Vom Unsinn und Sinn menschlichen Lebens. Vier Abhandlungen zur historischen Daseinsstruktur zwischen Differenz und Identität, Freiburg i. Brsg./München 1980, S. 139 – 174, hier: 154 – 158).
Und noch ein letzter Gedanke zum Kompromiss: Gefährdet ist die Freiheit zum Ausgleich dort, wo die Anerkennung einer legitimen gesellschaftlichen Pluralität und die Gesprächsfähigkeit der verschiedenen Akteure gerade im Namen einer bestimmten Moral negiert und das Austragen politischer Konflikte auf diese Weise verhindert wird. Kompromissfähigkeit bleibt ein Gradmesser für (partei-)politische wie (zivil-)gesellschaftliche Gesprächsfähigkeit gleichermaßen.
3. Gewissen
„Die Schule hat die Jugend zur Gottesfurcht und Nächstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit, zur Liebe zu Volk und Heimat, zum Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt, zu sittlicher Haltung und beruflicher Tüchtigkeit und in freier, demokratischer Gesinnung im Geiste der Völkerversöhnung zu erziehen.“
So heißt es in Artikel 33 der Landesverfassung von Rheinland-Pfalz. Ähnliche Beispiele lassen sich aus anderen Landesverfassungen finden. Diese Formulierung löste seinerzeit in meinen Lehrveranstaltungen hier an der Universität Trier immer wieder Verwunderung oder auch vehementen Widerspruch aus. Darf der Staat ein Bekenntnis zu Gott vorschreiben? Soll der Staat nicht vielmehr weltanschaulich neutral sein? Passt ein solcher Anspruch noch zu einer pluralen und offenen Gesellschaft? Und tatsächlich erhitzen sich gerade am Gottesbezug der Verfassung immer wieder die Gemüter. So war es bei der EU-Verfassung gewesen, so war es vor sieben Jahren einmal mehr in Schleswig-Holstein zu beobachten gewesen.
Es geht – wie auch bei der religiösen Eidesformel – nicht um ein persönliches Credo oder ein bestimmtes konfessionelles Gottesbild, sondern um eine kulturethische Aussage. „Es geht um die Anerkennung einer Verantwortung über die bloße Mehrheitsmeinung oder Opportunität hinaus.“ – so der Kulturpolitiker Thomas Sternberg (Das Kreuz – religiöses oder kulturelles Symbol? Über Kreuze in öffentlichen Gebäuden, in: engagement 31 [2013], H. 1, S. 19 – 28, hier: 24). Es geht um die Gründung der sittlichen Person, die noch einer anderen Instanz, ihrem Gewissen, gegenüber verpflichtet ist. Und es geht um die Rückversicherung gegenüber totalitären Tendenzen – wider eine Selbstüberschätzung des Menschen, wider einen Staat, der sich absolut setzt, wider jede Form des Materialismus, der den Menschen in letzter Konsequenz nur mehr als Funktionär der sozialen Verhältnisse betrachtet, ihm aber letztlich keine höheren geistigen Antriebe, Interessen oder Ziele zuzugestehen vermag. Das Bewusstsein des Subjekts würde auf das Überlebensinteresse des Kollektivs reduziert. Der Gottesbezug hält jene Leerstelle offen, ohne die letztlich auch die Freiheit des Menschen auf der Strecke bliebe. Wir Deutschen haben dies in zwei Diktaturen schmerzlich erfahren.
Die Ideologie der Freiheit darf niemals mächtiger werden als die konkrete Freiheit des Einzelnen. Denn der Mensch muss selbst bestimmen können, wer er sein will und wie er leben will. Dies verleiht ihm eine besondere, nur ihm eigene Würde. Ernst Moritz Arndt wusste in seiner nur fragmentarisch überlieferten Bildungstheorie: „Man kann in einer gewissen Bedeutung wohl der Beste und doch sehr beschränkt sein. Der Gebildetste zeigt eben darin seines Lebens Regel, daß er nichts zur Regel macht. […] Das Gesetz macht Knechte; sobald man aus dem Freiesten ein Gesetz macht, ist das freie Leben dahin, und ohne freies Leben will ich keine Gesellschaft, denn in ihr will ich ja eben vergessen, daß ich ein Knecht bin. Man mache also keine Gesetze aus Regeln, die nur so lange gut sind, als man nicht recht sagen kann, was sie sind. Die Guten und Gebildeten müssen die Zuversicht haben, sich selbst Maß und Regel sein zu können“ (Ernst Moritz Arndts Fragmente über Menschenbildung, nach d. Originalsausgabe neu hg. v. Wilhelm Münch u. Heinrich Meisner, Langensalza 2004, S. 179.).
Die Aufgabe, Ich zu sagen, die Anstrengung echter Charakterbildung können wir nicht an andere delegieren. Wo hingegen Bildung nicht mehr als Befähigung zur Selbstbestimmung verstanden, sondern auf ihre äußere soziale Seite und damit auf eine soziologisch beschreibbare Anpassungsleistung reduziert wird, wo der Zusammenhang von Bildung und Erziehung aufgelöst und Geltungsansprüche geleugnet werden (was im Grunde ein Selbstwiderspruch bleibt, da auch die Leugnung einen Geltungsanspruch setzt), ersetzt Aktion die Reflexion. Die rationale Abwägung wird durch Aktivismus ersetzt. Ein solcher schlägt schnell in Gewalt um, da gehandelt, das Handeln aber nicht mehr als begründet ausgewiesen wird. Wir erleben das, wenn es etwa heißt: Gendern, Inklusion, Klimaneutralität – einfach machen! Am Ende geht die Achtung vor dem freien Subjekt verloren. Dies zeigt, was mit einem stabilen, leistungsfähigen und wertorientierten Kulturstaat auf dem Spiel steht.
Eine Erziehung zur „Gottesfurcht“ – oder wie anders wir davon sprechen wollen –, zur Freiheit im Denken und Handeln sowie zur sittlichen Verantwortung ist nicht operationalisierbar und intentional zu erzeugen. Sie bedarf des erzieherischen Umgangs und des lebendigen Vorbilds. Daran ist zu erinnern in Zeiten, in denen Bildung oftmals so etwas wie das neue Heilsversprechen der säkularisierten „Wissensgesellschaft“ geworden ist.
Ein Letztbezug schützt davor, den Anspruch auf Bildung quasireligiös zu überhöhen, in Gestalt einer pädagogischen Kontrollgesellschaft, einer Erziehungsdiktatur oder durch manipulative Pädagogisierung aller Lebensbereiche. Ohne Letztbezug im weitesten Sinne, so die Überzeugung der Verfassungsväter, wäre eine Bildung der sittlichen Person gar nicht denkbar. Bildung kann zwar den Raum eröffnen, die Sinnfrage zu stellen, einen letzten Lebenssinn findet der Einzelne in ihr jedoch nicht. Bildung verweist den Einzelnen auf sich selbst, seinen Lebenssinn zu suchen und jene Wahrheit zu erkennen, die ihn frei macht – frei jenseits aller menschengemachten Bildungsanstrengungen.
Der moderne Staat, der die Freiheit seiner Bürger nicht durch eine teleologische Ordnung normiert, kann nicht selbst sittliche oder geistige Zwecke setzen. Dies begrenzt den Staat: Den eigenen Bestand wie seine Produktivität wird der freiheitliche Rechts- und Verfassungsstaat nur sichern, wenn seine Bürger zur Selbsttätigkeit freigesetzt werden. Er muss hierfür aber den notwendigen Rahmen zur produktiven Entfaltung von Freiheit setzen. Mit einem Artikel wie dem eben zitierten trifft der Verfassungsgesetzgeber eine wichtige Wertvorentscheidung. Dabei geht es um eine soziale Verantwortung für Werte und Normen, Ethos und Tradition, Kultur und Religion, die weit über unsere eigene Gegenwart hinausreicht. Denn wie künftige Generationen leben, denken und handeln werden, wird wiederum davon beeinflusst werden, wie wir heute leben, denken und handeln.
Gemeinsame Orientierungswerte, sozialer Zusammenhalt und Bürgersinn stehen als Ressourcen nicht beliebig zur Verfügung. Die Fundamente, die Staat und Gesellschaft zuammenhalten, müssen gepflegt werden. Ein Gemeinwesen sollte daher mit seinen Traditionen, dem Wissen um seine kulturelle Herkunft und Identität nicht allzu verschwenderisch oder leichtfertig umgehen, wenn diese Fundamente nicht bröckeln sollen. Gerechtigkeit im Staat wird technokratisch, wenn sie nicht mehr auf den Tugenden seiner Bürger fußt. Diese bleiben unverzichtbar für ein humanes und geordnetes Zusammenleben. Unser gesellschaftliches Ethos hat eine Grundlage in der Freundschaft unter Bürgern, die auch Krisen durchstehen lässt. Sie „beruht auf der Vorzüglichkeit ihrer seelischen Veranlagung, auf der konzentrierten Pflege solcher Veranlagung im Austausch mit den Freunden sowie auf der daraus sich erbildenden vernünftigen Einsicht“(Joachim Negel: Freundschaft. Von der Vielfalt und Tiefe einer Lebensform, Freiburg i. Brsg. 2019, S. 127). Wo dieses Ethos zerfällt, setzen über kurz oder lang politische, soziale und kulturelle Verteilungskämpfe ein.
Die freiheitliche Verfassung liefert zwar Orientierungsmaßstäbe, wie die Ziele der Verfassung hingegen innerlich verwirklicht werden, bleibt Sache des mündigen Bürgers. Dem Bürger bietet dies die Möglichkeit der Wahl, bedingt aber auch einen Zwang zur Entscheidung. Es liegt an uns, die „Leerstelle“ der weltanschaulich neutralen Verfassungsordnung inhaltlich mit gelebten Orientierungswerten zu füllen. Das ist etwas anderes, als christliche Symbole aus dem öffentlichen Raum zu verbannen, wie im Münsteraner Friedenssaal geschehen oder auf der Kupppel des Berliner Stadtschlosses geplant.
Erst aus dem sichtbaren Vorhandensein sich überschneidender, auch konkurrierender Orientierungswerte gewinnt die freiheitliche Verfassungsordnung inhaltliche Erfüllung und sittliche Maßstäbe. Und zu diesen gehört auch ein Wissen um die Grenzen der Kompromissbereitschaft.
4. Rote Linien
Die Rote Linie ist ein geflügeltes Wort der Politik. Bei Demonstrationen gegen die Coronapolitik waren vor einem Jahr Transparente zu sehen, auf denen stand: „Wir sind die rote Linie.“ Aktivisten der „Letzten Generation“ twitterten im März dieses Jahres: „Hier ist die rote Linie.“ – und drohten, „wenn ihr darüber geht“, mit zivilem Widerstand. Parteien berufen sich darauf, wenn sie Bereiche absichern wollen, die zum Kern ihrer Identität gehören. Für die einen ist es der Atomausstieg, für die anderen die Schwarze Null. Solche Grenzziehungen sind sehr oft ideologische oder strategische Bekenntnisse, etwa gegenüber den eigenen Anhängern oder dem Koalitionspartner.
Und doch: Politische Ethik braucht die Rote Linie.Politische Konflikte sollten nicht über Gebühr zu moralischen Ziel- oder Gewissenskonflikten aufgebaut werden. Umgekehrt gilt aber auch: Ohne Wertbindung verkommt Kompromisshandeln letztlich zur Willkür. Wenn Kompromisse der ethischen Anstrengung bedürfen und ihre Verfahren sich ethischer Bewertung aussetzen müssen, beinhaltet dies ebenso, dass in bestimmten Situationen auch die Verweigerung eines Kompromisses notwendig werden und sittlich verantwortlich sein kann. Nicht alle abstimmungsfähigen Positionen sind schon von vornherein legitime Alternativen des Guten, die im Rahmen des Richtigen nebeneinander stehenbleiben können. Würden wir anderes annehmen wollen, wäre der Menschenwürdegarantie, die aller Verfassung voransteht, im Letzten der Boden entzogen.
Politische Urteilskraft braucht beides: auf der einen Seite die Bereitschaft, sich zu binden, und Loyalität, eine Bindung auch aufrechtzuerhalten; auf der anderen Seite aber auch die Bereitschaft, eigene Vorverständnisse, Motivationen und Überzeugungen immer wieder zu überprüfen und zu korrigieren.
Verantwortliche Urteilsfähigkeit in politischen Dingen bedarf der notwendigen Distanz und Kritik gegenüber den verschiedenen politischen Doktrinen, Programmen, Konzepten oder Praktiken, aber auch der notwendigen Selbstkritik gegenüber dem eigenen politischen Urteilen und Verhalten. Dies ist kein Aufruf, zur Abstinenz vom politischen oder gesellschaftlichen Leben – im Gegenteil. Wohl aber zu Nüchternheit und einem gerüttelten Maß an Skepsis gegenüber gesellschaftlicher Wirklichkeit, wie es der frühere Salzburger Rektor, Wolfgang Beilner, ausgedrückt hat: „Man soll die eigene wie die fremde ‚Korruptionsanfälligkeit‘ in keiner Weise übesehen“ (Wolfgang Beilner: Der Christ in Staat und Gesellschaft oder Die Fleischtöpfe Israels, Graz u. a. 1982, S. 160).
Ernsthaftes Bemühen um Bildung und damit eben auch um Bildung des eigenen Gewissens bleibt eine unverzichtbare Voraussetzung für die individuelle Freiheit des politischen Urteils und der politischen Entscheidung. Denn auch wenn politische Entscheidungen kollektiv getroffen werden, entbindet dies den Einzelnen nicht, seine Zustimmung oder Ablehnung einer Parteientscheidung ethisch zu verantworten, weder als Funktionsträger noch als Mitglied. Ein wichtiger Gradmesser zur Rechtfertigung oder Ablehnung von Parteibeschlüssen bleibt dabei das Maß an Fremd- oder Selbstbindung, das ein Mitglied mit einer Entscheidung übernimmt. Bei schwerwiegender Materie stellt sich die Frage, ob eine Mitgliedschaft als solche noch aufrechterhalten werden kann oder nicht. Das Gesagte gilt allerdings nicht allein für Parteien.
Jede Entscheidung zu einer Mitgliedschaft bleibt eine Kompromissentscheidung, da wohl niemals eine vollständige Kongruenz zwischen korporativen und individuellen Zielen oder Überzeugungen angenommen werden kann – erinnern wir uns an Thielickes Wort vom Kompromiss als Paradigma menschlichen Lebens schlechthin. Jede Mitgliedschaft, jedes Mitwirken in einer Gemeinschaft vermittelt gehaltvolle soziale Erfahrungen. Zur sittlichen Verantwortung der Gemeinschaft gehört es, Individualität und freie Entfaltung ihrer einzelnen Mitglieder zu garantieren, in gegenseitigem Zusammenhalt, Verstehen und Fördern. Dem Einzelnen ermöglicht diese Erfahrung, sich zu bilden und weiterzuentwickeln, im Ringen um gemeinsame Überzeugungen und im Streben nach gemeinsamen Zielen.
Allerdings sind gemeinsame Überzeugungen und Ziele kein fester Besitzstand. Wenn eine Organisation oder Gemeinschaft daher grundlegend ihren Charakter, ihre Wertgrundlage, ihre Programmatik oder ihre Ziele verändert, kann bei aller notwendigen Loyalität und beim bleibenden Wert langfristiger Bindungen ein Austritt die verantwortliche Konsequenz sein. Bindung und Exit sind zwei Kehrseiten ein und derselben Medaille; beide gehören für eine Ethik der Mitgliedschaft zusammen. Dabei wird ein Austritt umso schwerer fallen, je mehr es nicht allein um begrenzte, funktionale, strategische Interessengemeinschaften geht, sondern um stärker von gemeinsamen Idealen, Traditionen oder Freundschaften getragene Zusammenschlüsse.
Der Vortragende hat seinerzeit über eine Verantwortungsethik politischer Parteien aus christlich-sozialethischer Perspektive promoviert – und musste gerade für das Kapitel zur Mitgliederethik im Oberseminar deutlich streiten. Fällt es leichter, über politische Verantwortung zu sprechen, wenn diese abstrakt bleibt oder nur „die da oben“ betrifft!? Ich lasse die Frage offen.
Siebzehn Jahre nach Abschluss der Dissertation und achtundzwanzig Jahre nach Eintritt war für ihn der Moment zum Parteiaustritt gekommen. Eine Politik ohne rote Linien, wie Scholz sie in einem Interview vor etwas mehr als einem Jahr für die Coronabekämpfung ausgab, verneint nicht nur jegliche ethische Anstrengungsbereitschaft, bei den coronapolitischen Wertkonflikten einen moralisch qualifizierten Ausgleich zu finden, sondern auch die roten Linien der Verfassung. Aber damit wären wir bei einem anderen Thema, für das hier nicht mehr Raum und Zeit ist.