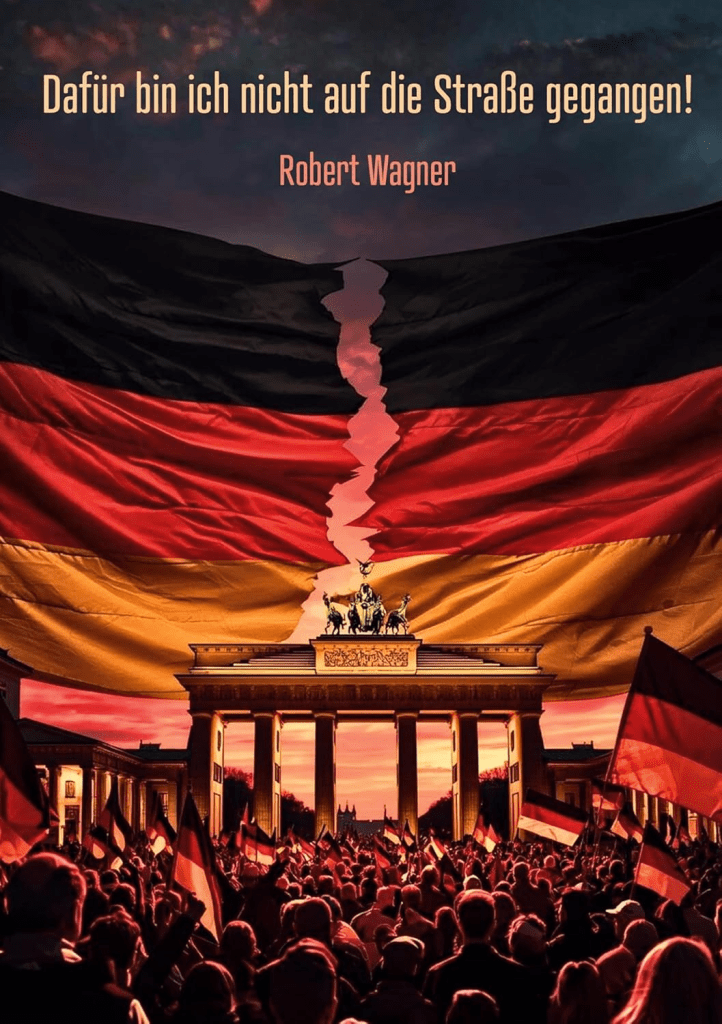Axel Bernd Kunze: Erziehen als Beruf – zwischen Betreuung und Bildung. Überlegungen aus der Perspektive sozialpädagogischer Fachschulen, in: Thomas Böhme/Jens Dechow/Andreas Sander (Hgg.): Die Zukunft evangelischer Kitas gestalten. Impulse zum aktuellen Bildungsbericht „Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder“ (Evangelische Bildungsberichterstattung; 7), Münster (Westf.)/New York: Waxmann 2026, S. 207 – 224; auch als E-Book: doi: https://doi.org/10.31244/9783818850975.
Aus der Einleitung der Herausgeber:
Axel Bernd Kunze geht in seinem Beitrag „Erziehen als Beruf – zwischen Betreuung und Bildung. Überlegungen aus der Perspektive sozialpädagogischer Fachschulen“ auf den Fachkräftebedarf und die damit verbundenen Herausforderungen ein. Er nimmt zunächst eine historische und bildungspolitische Verortung vor und verweist auf die Ambiguität gesellschaftlicher Anforderungen an die Institution der Kindertageseinrichtung, welche zwischen Bildungsanspruch und Versorgungsfunktion oszilliere. Es komme darauf an, frühkindliche Bildung alseigenständigen pädagogischen Auftrag zu begreifen und zu gestalten, in welchem bildungsorientierte Zugänge einerseits und sozialpädagogische Zugänge
andererseits zu verschränken seien. Damit stellen sich für evangelische Fachschulen komplexe Herausforderungen für das Berufsverständnis, die Ausbildungswege und die Berufszufriedenheit pädagogischer Fachkräfte, und in der Folge für deren Qualifikation, wie auch anhand vorliegender Daten zur Nachwuchs- und Ausbildungssituation gezeigt wird.
Die Folgen dieser Ausgangslage werden sowohl gesellschaftlich als auch in Bezug auf die Attraktivität des Berufs der Erzieherinnen reflektiert. Sehr konkret werden sodann Möglichkeiten aufgezeigt, die Ausbildungssituation den aktuellen Herausforderungen anzupassen. Auch wird die Schlüselrolle konfessioneller Ausbildungseinrichtungen in ihrer Ausrichtung herausgearbeitet, nicht nur Fachwissen zu vermitteln, sondern auch wertebezogene und religionspädagogische Kompetenzen an die Hand zu geben, die für eine gelingende Bildungspartnerschaft mit Familien zentral seien.
Freie Downloadmöglichkeit: https://www.waxmann.com/buecher/Die-Zukunft-evangelischer-Kitas-gestalten