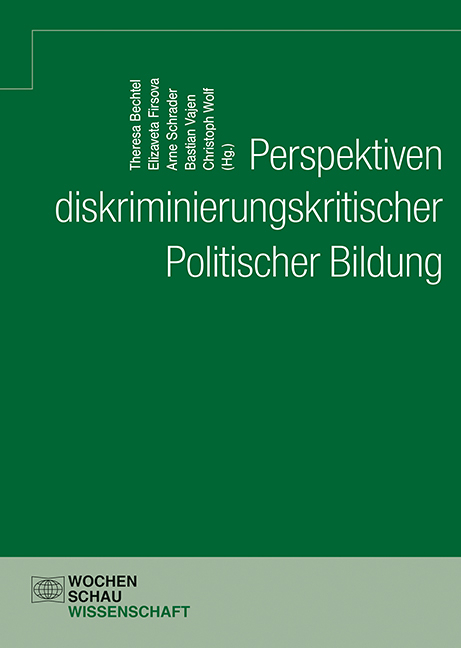Am 20. Januar 1988 wurde die ADV Helenia Monasteria zu Münster gegründet. Die älteste Damenverbindung Nordrhein-Westfalens konnte somit im Januar 2025 ihr fünfunddreißigstes Stiftungsfest feiern, und dies mit einem klangvollen und würdigen Kommers im vollbesetzten Kneipsaal auf dem Haus der V.K.D.St. Saxonia Münster. Die Gründerinnen brachten seinerzeit bereits Erfahrungen als Couleurdamen mit, die sie bei zwei christlichen, männlichen Lebensbünden in Münster gesammelt hatten. Dass diese Verbindungen heute noch tragen und gelebt werden, bewiesen die zahlreichen Grußworte auf dem Festkommers.
Helenia Monasteria, namensgebend waren Xenophons „Hellenika“ wie der mittelalterliche Stadtname Münsters, beeindruckt durch ihren breiten Zirkel, der Couleurhändlern bei der Gravur einiges abverlangt. Die Verbindung trägt die Farben Silber-Grün-Gold und folgt den Prinzipien Amicitia, Apertia, Sententia und Scientia. Silber steht für Wahrheit, Grün für Münster und das Münsterlands sowie Gold für die Freundschaft. Die Damenverbindung hat sich den einprägsamen Wahlspruch „Amore, more, ore, re iunguntur amicitiae“ gegeben.
Seit 2017 bildet Helenia Monasteria mit der ADV Concordia Feminarum zu Kiel, der Mädelschaft Bremensia zu Braunschweig, der ADV Victoria Hannover und der ADV Gratia Aurora Greifswald das Norddeutsche Kartell weiblicher Korporationen. Die Stiftungsfestrede am 18. Januar 2025 hielt der Bildungsethiker und Erziehungswissenschaftler Axel Bernd Kunze, der an der Universität Bonn lebt. Passend zum Bundestagswahlkampf stand diese unter der Frage: Wie kann ein fairer Diskurs eingeübt werden? Wir dokumentieren die Festrede im Anschluss. Das klangvolle Stiftungsfest zeugte vom Blühen, Wachsen und Gedeihen der Münsteraner Damenverbindung, die in den dreieinhalb Jahrzehnten ihres Bestehens eine stabile Hohedamenschaft und Aktivitas ausgebildet hat.
Wie kann ein fairer Diskurs eingeübt werden? [1]
Studentische Korporationen sind aus guten Gründen parteipolitisch neutral. So soll es auch heute Abend bleiben. Dennoch – oder gerade deshalb – passt das gewählte Thema aber möglicherweise doch zum vorgezogenen Bundestagswahlkampf, der in diesen Tagen an Fahrt aufnimmt. APERTIA und SENTENTIA und SCIENTIA sind drei Ihrer Prinzipien, wie ich gelesen habe, an welche die folgenden Gedanken möglicherweise anknüpfen können. Dies alles aus einer bildungsethischen Perspektive.
Zuvor – bevor wir den Blick wieder weiten: Ein Blick auf das gegenwärtige akademische Milieu
Akademische Freiheit, der sich Korporationen verpflichtet wissen, ist heute nicht allein durch staatliche Eingriffe bedroht, sondern gleichfalls durch zivilgesellschaftlichen Konformitätsdruck, Diskurskontrolle oder Diskursvermachtung. Abweichende Positionen werden im wissenschaftlichen oder öffentlichen Diskurs schnell moralisch stigmatisiert, Differenzen nicht mehr im argumentativen Ringen und im diskursiven Streit ausgetragen, sondern von vornherein durch Boykott, Bashing oder Mobbing aus der Diskursarena ausgeschlossen. Der Toleranzanspruch pluraler Gesellschaften verkehrt sich so ins Gegenteil. Von neuem einzuüben, ist eine Diskurskultur, die vom Mut zum eigenen Gedanken und zur produktiven Kontroverse lebt.
Als Reaktion auf solche Entwicklungen gründete sich im Februar 2021 das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Dieses beklagt in seinem Gründungsmanifest, dass es vielfach wissenschaftliche Akteure selbst seien, welche die Verfolgung abweichender Positionen organisierten: „Einzelne beanspruchen vor dem Hintergrund ihrer Weltanschauung und ihrer politischen Ziele, festlegen zu können, welche Fragestellungen, Themen und Argumente verwerflich sind. Damit wird der Versuch unternommen, Forschung und Lehre weltanschaulich zu normieren und politisch zu instrumentalisieren. Wer nicht mitspielt, muss damit rechnen, diskreditiert zu werden.“ [2]
Eines sei aus eigener Erfahrung deutlich gesagt: Beim aktuellen Ringen um wissenschaftliche Diskursfreiheit sollte nicht allein auf Formen von Zensur der Wissenschaft, sondern zugleich auch auf solche von Zensur durch Wissenschaft geachtet werden – und kollegiale Repression kann mitunter noch repressiver sein als solche von außen, weil sie unter dem Radar rechtlicher Absicherungen läuft und juristisch schwer greifbar ist.
Der Einsatz für eine freiheitliche, lebendige Streit- und Debattenkultur bleibt eine beständige Aufgabe. Denn wo die Freiheit der akademischen Rede unter die Räder kommt, steht viel auf dem Spiel: unter anderem die Leitungsfähigkeit und das Ansehen der Hochschulen unseres Landes, damit am Ende auch volkswirtschaftliche Produktivität, gesellschaftliche Entwicklung, kulturelle Vitalität und technische Innovation, aber auch gesellschaftlicher Friede und politische Stabilität. Wer lehrt, forscht und studiert muss seine Rolle selbst auf Sinn hin auslegen und die Fragen, mit denen er sich beschäftigt, selbst auf ihre Geltung hin befragt haben. Weder der Staat noch andere gesellschaftliche Agenturen dürfen die selbsttätige Wahrheitssuche und das faire Ringen um das bessere Argument durch Vorbehalte einschränken, wenn der Prozess wissenschaftlicher Erkenntnissuche produktiv und innovativ bleiben soll.
Wer studiert, lehrt und forscht, wird kein distanzierter Beobachter bleiben können. Im wissenschaftlichen Diskurs wird jeder der Beteiligten immer auch ein Stück seiner Persönlichkeit preisgeben – und macht sich damit auch angreifbar. Der Schutz eines freien Diskurses, ist daher unverzichtbar. Ja, es geht dabei nicht um Kleinigkeiten. Wer studiert, soll nicht etwas für gut halten, weil die Hochschule dies vorschreibt. Wer studiert, soll zum eigenständigen Werten und zum Beurteilen von Alternativen befähigt werden – dies gilt für jeden Bildungsprozess. Der frühere Wiener Pädagoge Marian Heitger hat dies einmal so ausgedrückt:
„Das Lehren muß die Freiheit der Vernunft achten, sonst verstößt es gegen die Menschenrechte. […] Wer für die zu lernenden Aussagen das Argumentieren verweigert, verletzt Menschenrecht; wer Zustimmung zu vorgestellten Aussagen erschleicht, der verletzt Menschenrecht; wer Methoden des Lehrens vorschreibt, die das kritische Prüfen ausschließen, verletzt Menschenrecht.“ [3]
Erziehender Unterricht sollte die Educandi immer zur eigenständigen Wertung des Gelernten befähigen. Eine bestimmte Schwelle aber darf dabei nicht überschritten werden: Welche Handlungsoptionen sich aus den erarbeiteten Kenntnissen und Fertigkeiten ergeben, kann im Unterricht nur hypothetisch reflektiert werden – will dieser nicht übergriffig werden. Andernfalls droht eine problematische Vermischung von Lehre und Lebenswelt. Didaktische Situationen sollen die Handlungsfähigkeit der Heranwachsenden fördern, sie müssen sich aber versagen, deren Handlungsbereitschaft intentional zu steuern. Kriterienorientiert bewertet werden dürfen allein die kognitiven Anteile des Bildungsvorgangs, nicht die Gesinnung. Dem Lehrenden ist ein motivloses Wohlwollen abverlangt: Im Bildungsprozess darf allein die Selbstbestimmung der Lernenden vorab bestimmt werden, nicht aber, welchen Gebrauch die Lernenden von dem Vermittelten machen.
Das heißt nicht, Bildungsprozesse sollten moralisch indifferent daherkommen. Doch sind bestimmte Tugenden, Bürgerhaltungen oder Dispositionen nicht als Inhalte vermittelbar. Diese entwickeln sich im personalen und gemeinschaftlichen Umgang, sind also eine Frage der Erziehung. Verstanden in einem weiten Sinne: Der Bildungsauftrag verlangt nach Vermittlung von Wissen und Kompetenzen. Der Erziehungsauftrag verpflichtet dazu, Hilfen anzubieten, wie Wissen und Kompetenzen lebensdienlich und gemeinwohlförderlich eingesetzt werden können.
Die hierfür notwendigen Orientierungswerte sind nicht intentional zu vermitteln, sie wachsen in einem Lernklima, das selbst durch Werte geprägt ist. In Bildungseinrichtungen gehört dann auch beides zusammen: die Vermittlung von Kenntnissen und Kompetenzen auf der einen sowie Tugend- und Werterziehung auf der anderen Seite. Denn – so der Pädagoge Roland Reichenbach – „Kompetenzen sind nicht ‚an sich‘ gut, und natürlich lassen sie sich auch strategisch fragwürdig einsetzen. […] Die Tugend bezeichnet wie die Kompetenz ein (lebenspraktisches) Können, aber darüber hinaus verstärkt sie ein Wollen und verlangt vom Einzelnen gewissermaßen in direkter Unbedingtheit, gemäß seiner Einsichten zu handeln, was bei ‚bloßen‘ Kompetenzen nicht der Fall ist.“ [4]
Wo Bildungs- und Erziehungsfragen hingegen nicht mehr unterschieden werden, droht eine Moralisierung des pädagogischen Prozesses. Und wo suggeriert wird, das Werturteil stehe bereits fest und müsste pädagogisch oder akademisch nur noch exekutiert werden, bleibt für eine Prüfung des Gelernten kein Raum mehr. Am Ende stünden nicht Schülerinnen und Schüler oder Studenten und Akademiker, die selbständig denken, sondern solche, die es verlernt haben, selbständig zu denken.
Meinungsgerechtigkeit
Vor allem bei politisch strittigen Fragen stehen Lehrende, ob in Hochschule, Schule oder anderswo, vor der Entscheidung, wie sie ihrer Verpflichtung zur weltanschaulich-politischen Neutralität nachkommen können, ohne in Beliebigkeit oder Standpunktlosigkeit zu verfallen. Das formale Ziel, zur eigenständigen Urteilsfindung und zum bewussten Handeln zu befähigen, hebt die geforderte Neutralität gerade nicht auf, im Gegenteil.
Überschritten werden die Grenzen nichtneutraler Lehre dort, wo eine gewünschte Haltung didaktisch erzwungen werden soll, gleich ob es um eine parteipolitische, konfessionelle oder weltanschauliche Sichtweise oder eine fachliche Wertung geht. In einer pluralistischen, freiheitlich-demokratischen Gesellschaft wird es immer eine Vielzahl unterschiedlicher Vorstellungen des Guten geben, die im Rahmen des Richtigen gleichermaßen zulässig sind und gleichberechtigt nebeneinanderstehen können. Die Einzelnen sind gefordert, zwischen ihnen eine subjektive Entscheidung zu treffen.
Elisabeth Meilhammer, Professorin für Erwachsenen- und Weiterbildung an der Universität Augsburg, hat vorgeschlagen, Neutralität in Lehr- und Lernprozessen konzeptionell nicht als Meinungsabstinenz, sondern als Meinungsgerechtigkeit zu fassen. Diese legt sie in Gestalt von fünf Grundannahmen [5] dar:
(1) Die Lehrenden sollten nicht auf eigene Stellungnahmen verzichten; sie dürften aber keine eigenen Interessen im Blick auf das Prozessergebnis verfolgen, indem sie bestimmte Akteure im Willensbildungs- und Aushandlungsprozess bevorzugen oder benachteiligen.
(2) Pädagogisch ist eine Wirkungsneutralität niemals möglich. Der pädagogische Prozess zeitigt immer Wirkungen. Neutralität könne es allenfalls angesichts verschiedener partikularer Begründungen des Handelns geben.
(3) Dabei gehe es um einen Kommunikationsprozess, der bestimmten Regeln und Prinzipien unterworfen ist und in dem Argumente gleichberechtigt vorgetragen und geprüft werden können. Unzulässig im Prozess der Meinungsbildung sollten allein solche Argumente sein, die davon ausgehen, dass einer bestimmten Person ein höherer intrinsischer Wert zuzusprechen ist als einer anderen.
(4) Neutralität beziehe sich auf den Widerstreit verschiedener nebeneinanderstehender Konzeptionen des Guten. Dieser Widerstreit setze einen Rahmen des Richtigen voraus, innerhalb dessen Grenzen fair um die verschiedenen Standpunkte gerungen werden kann. Dieser Rahmen muss auf Basis der verfassungs- und grundrechtlichen Prinzipien so weit wie möglich und rechtlich präzise abgesteckt sein.
(5) Vorausgesetzt wird dabei eine demokratische Gesellschaft, in der dieser Rahmen durch die Beteiligung aller gemeinsam getragen wird.
Ein Diskurs, der diesen Annahmen gerecht wird, muss in Zeiten zunehmender „Cancel Culture“ und eines vielfach moralisch, emotional oder politisch aufgeladenen akademischen Gesprächsklimas von neuem eingeübt werden. Es braucht neuen Mut zu einem kontroversen Lernen.
Kontroverses Lernen
Meinungsgerechtigkeit wird vor allem bei gesellschaftlich kontroversen Fragen relevant, und dies mitunter recht heftig. Der Widerstreit der Meinungen kann für die Beteiligten in bestimmten Fällen zu einer regelrechten Zerreißprobe werden. Toleranz ist nicht als Gleichgültigkeit misszuverstehen: Wo jemand in den Augen anderer irrt, muss er Widerspruch ertragen, aber als Person weiterhin geachtet bleiben.
Die eigenständige und unvoreingenommene Urteilsbildung im Rahmen „kontroversen Lernens“ erfordert, Fähigkeiten didaktisch-methodisch zu fördern, die wichtige Grundlagen für das demokratische Zusammenleben legen: Sich eine eigene Meinung zu bilden, setzt beispielsweise die Fähigkeit voraus, sich nach allen Seiten zu informieren, verschiedene Positionen vorurteilsfrei zu prüfen und auch kontroverse Standpunkte zur Kenntnis zu nehmen. Die verschiedenen Standpunkte müssen gedanklich durchdrungen und sorgfältig geprüft werden, die eigene Position stets sachlich begründet werden. Zugleich ist eine Haltung zu fördern, die auch dem eigenen Urteil kritisch gegenüberstehen lässt; dieses sollte beständig überprüft und, wenn geboten, revidiert werden. Gerade die pädagogische Tugend gesunder Skepsis, die darum weiß, dass selbst das sorgfältigste Urteil nur bis zum Erweis des Gegenteils gilt, bleibt wiederzuentdecken. Wissenschaft und Pädagogik suchen nach der Wahrheit, dürfen aber niemals absolute Wahrheiten verkünden.
Pädagogisch wie ethisch ist die Tatsache gesellschaftlicher Pluralität angemessen anzuerkennen. Dies verlangt „weder die Aufgabe der eigenen Überzeugungen und der Frage nach der Wahrheit noch die Behauptung der Richtigkeit aller vertretenen Positionen“ [6]. Das Ringen um widerstreitende Positionen darf nicht durch Verbote beendet werden, sondern sollte auf Grundlage einer gemeinsam geteilten formalen Sittlichkeit ausgetragen werden.
Sicherung fairer Diskursbedingungen
Beutelsbach – ist nicht nur der Name eines Weinortes im Remstal vor den Toren Stuttgarts. Und seine Erwähnung an dieser Stelle mehr als eine Reminiszenz des Festredners an den Standort seiner Fachschule, an der er tätig ist. Er bezeichnet auch jenen Konsens, dem es 1976 gelang, die Kontroversen in der seinerzeit parteipolitisch wie konzeptionell stark polarisierten Politikdidaktik zu befrieden. Auch wenn dieser Beutelsbacher Konsens mittlerweile in die Jahre gekommen ist, bleiben sein Anliegen und seine drei Grundprinzipien ungebrochen aktuell.
(1) Das Prinzip der Schülerorientierung will die Lernenden dazu befähigen, die politische Situation wie die eigene Position zu analysieren und politisch handlungsfähig zu werden.
(2) Ferner müssen die Inhalte in der politischen Bildung didaktisch so aufbereitet werden, dass Schüler diese denkend nachvollziehen können und nicht für eine bestimmte partikulare Position vereinnahmt werden (Überwältigungsverbot).
(3) Wer lehrt, muss didaktisch reduzieren. Doch dürfen dabei politische, gesellschaftliche oder wissenschaftliche Kontroversen nicht fahrlässig vereinfacht werden; was in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft kontrovers beurteilt wird, muss auch im Unterricht kontrovers dargestellt werden (Kontroversitätsgebot).
Die gegenwärtige Polarisierung innerhalb der politischen Debatte hat diese Forderungen keinesfalls einfacher werden lassen. Die Kontroversen müssen im Bildungsprozess auf dem Boden der Verfassung, aber ohne parteipolitische Wertung dargestellt und einsichtig gemacht werden, und zwar vor dem Hintergrund des Selbstverständnisses der jeweiligen Debattenlager. Dabei geht es nicht um Beliebigkeit oder Wertneutralität, sondern um Unvoreingenommenheit und die Fähigkeit, Kontroversen auszutragen – als Grundlage jeder fairen demokratischen Streitkultur.
Allerdings geschieht Überwältigung durch eine explizit parteipolitische Vereinnahmung heute vielleicht seltener, als dies möglicherweise zur Entstehungszeit des Beutelsbacher Konsenses der Fall gewesen sein mag. Sehr viel schwerer zu dechiffrieren, sind Überwältigungen, die aus einer fast flächendeckenden Milieugebundenheit einer Berufsgruppe oder einer bestimmten Disziplin erwachsen. Sehr häufig wird dann unter dem Anschein der Neutralität für ein vermeintlich alternativlos „Gutes“ geworben, das in der öffentlichen Debatte und eben auch im Unterricht nicht mehr befragt werden darf.
Wo aber Gegenpositionen gar nicht mehr zur Sprache kommen, weil sie von vornherein als diskussionsunwürdig etikettiert und aus dem gemeinsamen Gespräch ausgeschlossen werden, verkehren sich das Toleranz- oder Neutralitätsgebot in ein Machtinstrument – mit der Folge, dass die öffentliche Debatte auf Dauer verödet. Denn am Ende erstirbt das notwendige, mitunter harte Ringen um das bessere Argument. Es gibt unterschiedliche Ansichten über die Zukunft des Nationalstaates und die Bewertung der Globalisierung, den Umgang mit anhaltender Migration und die mögliche Bedeutung einer „Leitkultur“, die angemessene Reaktion auf die aktuellen sicherheitspolitischen Krisen und den rechten Umgang mit den geostrategischen Herausforderungen, über die nachhaltige Sicherung der wirtschaftlichen und sozialen Basis des Staates sowie den Umgang mit sozialethischen Orientierungswerten in einem zunehmend heterogener werdenden Gemeinwesen. Und über diese Fragen muss in der Demokratie gestritten werden dürfen.
Was ist pädagogisch zu fordern? Die Lehrperson sollte widerstreitende Positionen gerecht behandeln. Die Lernenden dürfen nicht für eine bestimmte Sichtweise vereinnahmt werden, indem persönliche Positionen nicht als solche gekennzeichnet oder Kontroversen ausgeblendet werden. Gerechte Parteilichkeit kann in einzelnen Fällen allerdings auch beinhalten, schwache, unterrepräsentierte Positionen advokatorisch zu stärken und einer einseitigen Wahrnehmung auf nichtmanipulative Weise gegenzusteuern, damit ein Problem multiperspektivisch in den Blick genommen werden kann und auch die Gegenseite mit ihren Argumenten Gehör findet.
Ferner bleibt es pädagogisch wichtig, auf die Möglichkeitsbedingungen für einen gelingenden Lern- und Gesprächsprozess zu achten. Entscheidend sind etwa eine angstfreie Gesprächsatmosphäre oder ein konstruktiver Umgang mit Konflikten. Es ist darauf zu achten, dass nicht einfach Meinungen in den Raum gestellt werden, sondern die Einzelnen ihre Positionen argumentativ ausweisen.
Zentral bleibt eine Haltung der Unvoreingenommenheit, die sich darum müht, die konfligierenden Positionen zunächst einmal vor dem jeweiligen Selbstverständnis der anderen redlich zu erfassen, also zu unterstellen, dass andere gleichfalls aus gutem Willen zu abweichenden Positionen oder Antworten finden können. Wo dies nicht geschieht, wird der andere zum Strohmann oder Pappkameraden aufgeblasen, also seine Position derart verzerrt, dass besser draufgeschlagen werden kann.
Dies alles verlangt das lebendige Vorbild des Lehrenden. Es braucht einen entsprechenden Umgang des Vertrauens, der Wertschätzung und des gegenseitigen Respekts: Nur dann werden die Einzelnen auch die Sicherheit gewinnen können, aus der Vielheit an Möglichkeiten ohne falsches Ressentiment das Eigene zu wählen und eine Wahl gegebenenfalls auch wieder zu revidieren. Der Einsatz für jene Werte, die für das Gelingen demokratischer Verstehens- und Verständigungsprozesse notwendig sind, wird dabei nur gelingen, wenn die Einzelnen zum Werten, zum eigenständigen sittlichen Urteilen und Entscheiden, befähigt werden. Genau dies entspricht dem aufklärerischen Anspruch, sich des eigenen Verstandes ohne Anleitung durch andere zu bedienen.
Ausblick
Eine lebendige Demokratie lebt nicht von Tabus, Denkverboten und Reglementierungen, sondern von der „Freiheit zu …“, von der Vielfalt an Alternativen und vom Wettstreit der Meinungen, der mitunter sogar sehr scharf ausgetragen werden kann. Die Sicherung einer Freiheit des Lehrens und Lernens bleibt unverzichtbarer Teil einer weitergehenden demokratiepädagogischen Verantwortung. Das Leitbild ist nicht der umfassend und stets politisierte Aktivbürger, was einer permanenten Politisierung aller Gesellschaftsbereiche gleichkäme, sondern der kompetente, beteiligungsfähige, am politischen Geschehen interessierte interventionsfähige Souverän, der bereit und fähig ist, sich einzumischen, wenn es darauf ankommt.
Es geht im Kern um die Stärkung praktischer Urteilskraft und damit um eine zentrale Bildungsaufgabe.Akademische wie pädagogische Freiheit sichert erweiterte didaktische Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten. Allerdings muss diese Freiheit, die kein fester Besitz ist, mit Leben gefüllt werden. Der Wuppertaler Kunstdidaktiker und Erziehungswissenschaftler Jochen Krautz mahnt: „Es bedarf eines Handlungswillens der […] am Bildungssystem Beteiligten, der deren innerer Freiheit entspringt. […] Mit dieser Willensdimension ist der von äußeren Bedingungen nicht abhängige und auch nicht determinierbare Raum personaler Selbstbestimmung angesprochen.“ [7]
Wo das Leistungsprinzip verkommt und Bildung allzu häufig auf ihre äußere soziale Seite und damit auf eine soziologisch beschreibbare Anpassungsleistung reduziert wird, verliert das öffentliche Gespräch an Tiefe und Niveau – mit deutlichen Folgen für die Qualität des öffentlichen Diskurses: Auf der einen Seite werden Bedingungen wissenschaftlicher Erkenntnisbildung unrealistisch eingeschätzt. Das differenzierte Werten kontroverser Positionen ist aber mehr als ein oberflächlicher „Faktencheck“.
Polarisierte politische Diskurse werden nach Ansicht der Kommunikationswissenschaftlerin Svenja Schäfer [8] verstärkt durch den Trend zu „Nachrichtenhäppchen“ (Snack News) und Kurzinformationen in sozialen Medien und Messengerdiensten. An dieser Stelle nur ein Beispiel aus der Coronazeit, auf das die Journalistin Anna Schneider im Dezember 2021 in einem Leitartikel für die WELT hingewiesen hatte: Sebastian Jobelius, SPD-Politiker im Berliner Bezirk Kreuzberg/Friedrichshain, habe die Impfdebatte im Kurznachrichtenkanal Twitter auf die knappe Formel „Impfpflicht = organisierte Solidarität = soziale Demokratie“ gebracht und die Impfpflicht damit kommunikativ sogar zu einem unverzichtbaren Pfeiler sozialstaatlicher Demokratie erklärt – nur ein Beispiel kommunikativer Vereinfachung und zugleich Überzeichnung von vielen. Die Rezipienten verschafften sich – so Schäfer – nicht mehr einen Überblick über Themen; sie fühlten sich zwar informiert, könnten ihr knappes Wissen aber nicht hinreichend einordnen und sich so selbstbewusst ein eigenes Urteil bilden.
Auf der anderen Seite wird das öffentliche Gespräch moralisierend aufgeladen. Denn wo ein differenziertes, streitbares Gespräch nicht mehr möglich ist, greifen Strategien der Vereinfachung, Banalisierung, Pauschalisierung, Etikettierung, Emotionalisierung oder moralisierender Aggressivität um sich. Verstärkt werden diese Tendenzen durch die Abneigung, Geltungsansprüche verbindlich einzufordern.
Wo aber Geltungsansprüche nicht mehr zugelassen werden, ersetzt am Ende Aktion die Reflexion. Die rationale Abwägung wird durch Aktivismus ersetzt. Ein solcher schlägt schnell in Gewalt um, da gehandelt, aber das Handeln nicht mehr als begründet ausgewiesen wird. Auf Dauer erstirbt die Achtung vor dem freien Subjekt. Auch Verstöße gegen das Überwältigungsverbot und Kontroversitätsgebot im öffentlichen Moraldiskurs sind Formen kommunikativer Gewalt.
Studentische Korporationen werden „unzeitgemäß“ bleiben, aber sie werden Zukunft haben, wenn sie ihren Mitgliedern das bieten, was dem öffentlichen und akademischen Diskurs leider allzu oft an Tiefe fehlt: eine Bildungs- und Erziehungsgemeinschaft, die groß vom Einzelnen denkt, die um den Ernst des Daseins weiß, die das Individuum zur Selbsttätigkeit freisetzen und nicht betreuen will, die zum Selberdenken herausfordert und jene Kräfte weckt, die notwendig sind, sich dem Zwang zum unproduktiven Gruppendenken zu widersetzen. Ein durchaus anspruchsvolles Programm!
Für die Gesellschaft erfüllen solche Bildungsgemeinschaften eine zunehmend wichtiger werdende Rolle als kulturethisches Gedächtnis. Norbert Bolz spricht am Ende seines leidenschaftlichen Plädoyers „Die ungeliebte Freiheit“ vom Mut zur bürgerlichen Lebensführung, den wachzuhalten, heute dringend geboten ist: „Denn zu nichts braucht man heute mehr Mut als zur Wahrnehmung des Positiven. Und damit erweist sich der Bürger auch als der letzte Träger der Aufklärung, der das ‚sapere aude‘ in eine Lebenspraxis der Freiheit umsetzt. Kants Mut zum Selberdenken konkretisiert sich heute als Mut zur Bürgerlichkeit. So hat Odo Marquard den Begriff Zivilcourage übersetzt. Es gibt noch Ritterlichkeit, auch wenn es keine Ritter mehr gibt. Und es gibt noch Bürgerlichkeit, auch wenn es keine bürgerliche Gesellschaft mehr geben sollte.“ [9]
Und – so ließe sich anfügen – es wird akademisches Leben geben, so lange studentische Korporationen sich ihrer Aufgabe als akademische Bildungs- und Erziehungsgemeinschaften, getragen durch die starken Werte eines lebenslangen Freundschaftsbundes, bewusst bleiben und diese mit Leben füllen.
In diesem Sinne gratuliere ich Ihnen sehr herzlich zum heutigen Stiftungsfest und wünsche ich Ihrer Verbindung weiterhin ein erfolgreiches Blühen, Wachsen und Gedeihen.
[1] Schriftliche Fassung der Festrede zum 35. Stiftungsfest e. v. ADV Helenia Monasteria am 18. Januar 2025 a. d. H. e. s. v. V.K.D.St. Saxonia zu Münster.
[2] Manifest – Netzwerk Wissenschaftsfreiheit [Aufruf: 19.02.2025].
[3] Heitger, Marian: Menschenrechte in der Erziehung – Erziehung zu den Menschenrechten. Vortrag mit Podiumsgespräch, gehalten in Salzburg am 16. November 1998. Köln u. a. 1999, S. 13 f.
[4] Roland Reichenbach: Zur demokratischen Dimension der Schule, in: Pädagogikunterricht, 34 (2014), H. 1, S. 2 – 11, hier: 9.
[5] Meilhammer, Elisabeth: Neutralität als bildungsethisches Problem. Von der Meinungsabstinenz zur Meinungsgerechtigkeit, Paderborn 2008, S. 114 f.
[6] Hilpert, Konrad: Theologische Ethik im Pluralismus, Freiburg i. Ue. 2012, S. 21.
[7] Krautz, Jochen: Bildungsreform, Demokratie und ökonomisches Menschenbild, in: Rekus, Jürgen (Hg.): Allgemeine Pädagogik am Beginn ihrer Epoche, Frankfurt a. M. 2012, S. 159 – 184, hier: 177.
[8] Vgl. Schäfer, Svenja; Karst, Bernd: „Kurze Nachrichten bestärken extremeres Auftreten.“ Im Gespräch mit Svenja Schäfer über ihre Forschung zu „Snack News“, in: Bildung real 129 (2021), H. 5-6, S. 27 – 29.
[9] Bolz, Norbert: Die ungeliebte Freiheit. Ein Lagebericht, München 2010, S. 136 [„Mut zur Bürgerlichkeit“ im Original kursiv hervorgehoben].